Wer spricht da eigentlich?
KI schreibt Texte – aber wer spricht da eigentlich? Wenn Botschaften automatisch entstehen, verschwimmen Urheberschaft und Verantwortung. Ein Essay über Sprache, Identität und Ethik im Zeitalter generativer KI.

Immer öfter lesen wir Texte, bei denen wir nicht wissen, wer sie eigentlich verfasst hat. Ein Interview, ein Newsletter, ein Artikel: gut geschrieben, treffend formuliert, aber ohne erkennbare Handschrift.
In Zeiten generativer KI verschwimmt der Ursprung von Sprache. Doch wenn wir nicht mehr wissen, wer spricht, was macht das dann mit dem, was gesagt wird?
Zwischen Effizienz und Entfremdung
In meinem Arbeitsalltag sind KI-gestützte Tools längst Standard. Sie helfen mir, Texte zu strukturieren, Gedanken zu sortieren oder sprachlich runde Formulierungen zu finden. Manchmal schreibe ich einen Absatz – manchmal die KI. Manchmal weiß ich es selbst nicht mehr genau.
Und genau darin liegt die Herausforderung: Kommunikation wird schneller, effizienter, skalierbarer – aber sie wird auch entkoppelt vom Menschen, der eigentlich dahinterstehen sollte. Von der Absicht, dem Kontext, der Haltung.
Wer steht für eine Aussage ein?
In klassischen Kommunikationsmodellen war klar: Es gibt einen Sender, eine Botschaft, einen Kanal, einen Empfänger.
Mit generativer KI wird dieses Modell porös. Wer ist der Sender, wenn der Text automatisch erstellt wurde? Wer trägt die Verantwortung für Wirkung, Missverständnisse oder sogar Manipulation?
Ein Beispiel: Unternehmen lassen Pressemitteilungen, E-Mails oder Blogbeiträge von KI-Systemen erstellen. Die Ergebnisse sind glatt, fehlerfrei, vielleicht auch überzeugend. Aber sind sie auch echt? Und falls nein – spielt das überhaupt eine Rolle bei uns Leser:innen?
Die Ethik der Sprache ist zurück
Vielleicht ist das der wichtigste Effekt von KI auf Kommunikation: Sie bringt uns zurück zu einer Frage, die wir lange vernachlässigt haben.
Was macht Sprache glaubwürdig, menschlich, wirkungsvoll?
Früher konnte man sich darauf verlassen, dass ein Text Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung oder zumindest sorgfältiger redaktioneller Arbeit war.
Heute müssen wir diese Qualität aktiv herstellen – gegen die Versuchung der generativen Fließbandproduktion.
Ethik in der KI-Kommunikation heißt deshalb nicht nur: keine Fakes, keine Deepfakes, keine Täuschung. Es heißt: Verantwortung übernehmen für die Wirkung von Sprache, auch – oder gerade – wenn sie maschinell erzeugt wurde.
Zwei Wahrheiten, eine Entscheidung
Wir leben gerade in zwei Kommunikationsrealitäten gleichzeitig:
- In der einen versprechen KI-Tools Effizienz, Geschwindigkeit und Output. Sie helfen dabei, mehr in weniger Zeit zu sagen.
- In der anderen erleben wir eine wachsende Unsicherheit: Wem kann ich glauben? Wer hat das geschrieben? Welche Haltung steckt wirklich dahinter?
Beide Realitäten schließen sich nicht aus. Aber sie fordern uns heraus, bewusster zu kommunizieren. Nicht trotz KI – sondern wegen KI.
Und jetzt?
Ich glaube: Die wichtigste Frage ist nicht, ob wir KI in der Kommunikation einsetzen sollen. Das tun wir längst.
Die Frage ist: Wie wollen wir sprechen – wenn Systeme für uns sprechen können?
Und: Was macht unsere Stimme eigentlich aus, wenn sie jederzeit simuliert werden kann?
- Vielleicht wird Authentizität zur neuen Währung.
- Vielleicht wird Haltung wichtiger als Stil.
- Vielleicht erkennen wir gerade erst, wie wertvoll echte Kommunikation ist.
Was denkst du?
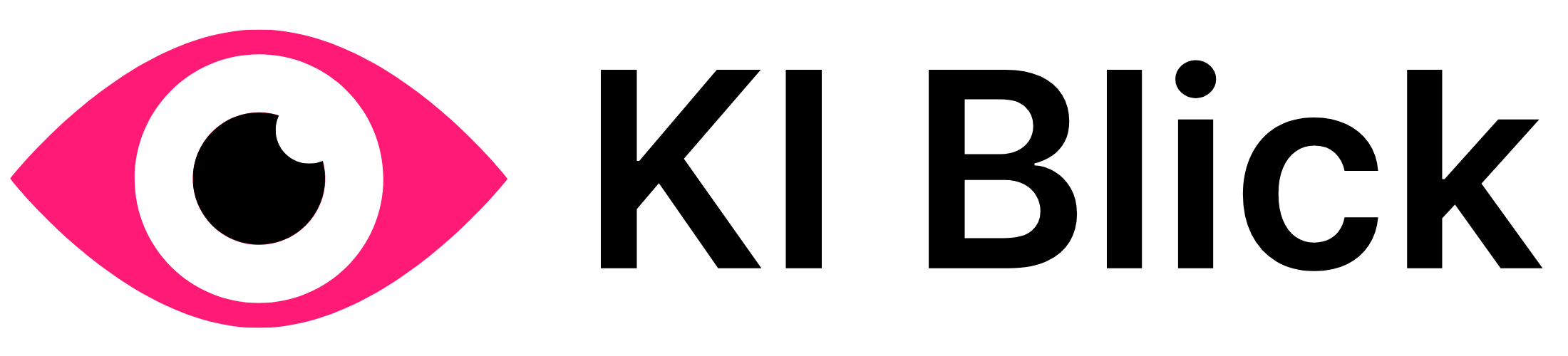
Comments ()