Wie KI unser Informationsverhalten auf den Kopf stellt
Die Suche hat sich verändert: KI liefert direkte Antworten, filtert Inhalte – und verändert damit unser Denken. Wer heute nach Wissen sucht, braucht neue Kompetenzen: im Fragen, Bewerten und Navigieren. Ein Erfahrungsbericht mit Ausblick.

Früher habe ich gegoogelt. Heute frage ich KI.
Und manchmal frage ich sogar gleich drei gleichzeitig.
Was sich nach Spielerei anhört, ist längst Alltag: Ich lasse mir Studien zusammenfassen, Begriffe erklären, unterschiedliche Sichtweisen liefern – schneller, intuitiver und oft viel präziser als mit klassischen Suchmaschinen.
Die Art, wie wir nach Wissen suchen, verändert sich grundlegend. Und das verändert mehr als nur unsere Tools.
Gerade erst habe ich mir die Google Keynote angesehen. Bekannte Routinen, wie das "googeln", wird sich zu einem völlig neuen Suchverhalten ändern.
Vom Link zur Antwort – und was dabei verloren geht
Suchmaschinen waren jahrzehntelang das Tor zum Wissen. Wer etwas wissen wollte, tippte ein paar Begriffe ein, klickte sich durch Links und filterte selbst.
Doch mit dem Aufstieg von KI-Systemen wie ChatGPT, Perplexity oder Ähnlichen ist etwas anderes gefragt: direkte Antworten, und nicht Links zu Websites.
„Zero-Click“-Suchen nehmen zu. Rund 58,5 % der Suchanfragen führen heute zu keinem einzigen Website-Klick. Die Antwort erscheint direkt – fertig zusammengefasst, meist ohne Quelle.
Das verändert nicht nur unsere Erwartungen. Es verändert unsere Fragen, unsere Geduld – und unsere Urteilsfähigkeit.
Drei Agent:innen, viele Rollen – mein digitaler Alltag
Ich arbeite längst in einem hybriden Team: Ich + meine KI-Agent:innen.
- Eine hilft beim Ideen-Clustering.
- Eine fasst lange Texte zusammen.
- Eine denkt mit, wenn ich komplexe Themen sortieren muss.
Was als praktische Hilfe begann, hat mein Informationsverhalten grundlegend verschoben:
Ich filtere weniger – ich bewerte mehr.
Ich lese weniger – ich frage gezielter.
Ich denke nicht linear – sondern iterativ, im Dialog mit der Maschine.
Das ist effizient. Aber es hat auch Risiken.
Wenn Aufmerksamkeit zum Engpass wird
Wir leben nicht in einem Informationsmangel. Ganz im Gegenteil: Wir sind ständig überversorgt. Was fehlt, ist Aufmerksamkeit. Und genau hier wirken KI-Systeme wie doppelte Agenten:
Sie helfen, Information zu verdichten – und sie entscheiden, was wir nicht sehen.
Das kann entlasten. Oder manipulieren.
Denn wenn Antworten zu schnell kommen, bleiben Fragen manchmal unausgesprochen:
Hätte es andere Perspektiven gegeben?
Wurden kontroverse Inhalte weggefiltert?
War das wirklich meine Frage – oder nur die gängigste Interpretation?
In einer Welt voller KI-gestützter Abkürzungen bleibt kritisches Denken umso wichtiger.
Von Prompt zu Pattern: Wie sich Suchverhalten automatisiert
Je häufiger ich KI-Tools nutze, desto häufiger beobachte ich etwas Interessantes:
Meine Suchanfragen folgen Mustern.
Ich greife auf ähnliche Formulierungen zurück, variiere kaum – einfach weil es effizient ist.
Ein Beispiel:
Wenn ich ein komplexes Thema aufbereiten will, beginne ich meist mit
„Erkläre [Thema] in einfachen Worten für Einsteiger:innen“.
Danach frage ich nach Kontroversen, dann nach Beispielen. Ein Ablauf, der sich bewährt hat, aber auch limitiert.
Was ursprünglich explorativ war, wird mit der Zeit formelhaft.
Ich gewöhne mir das Fragen ab.
Statt zu forschen, optimiere ich meine Prompts. Und verliere damit ein Stück Neugier.
Deshalb lohnt es sich, regelmäßig innezuhalten:
- Wann habe ich zuletzt eine Frage gestellt, auf die ich keine schnelle Antwort wollte?
- Wie oft habe ich mich überraschen lassen – statt gezielt durchzuprompten?
KI kann vieles, aber sie übernimmt nicht das Denken.
Gute Fragen bleiben unsere Verantwortung.
Was wir verlieren könnten
Wenn Maschinen für uns filtern, entscheiden sie auch mit:
Was ist relevant? Was gilt als vertrauenswürdig? Was taucht nicht auf?
Algorithmische Verzerrungen, fehlende Quellen, fehlende Diversität – das sind keine hypothetischen Probleme. Sie sind Teil des neuen Such-Alltags. Und sie betreffen alle, die Informationen nutzen, bewerten, weitergeben.
Wir brauchen neue Kompetenzen:
- Kontextbewusstsein.
- Prompt-Kompetenz.
- Digitale Urteilskraft.
Von der Suche zur Navigation – was jetzt zählt
KI-basierte Suche ist kein besseres Google. Sie ist ein neues Betriebssystem für Wissensarbeit. Statt zu scrollen, führen wir Gespräche. Statt zu recherchieren, kuratieren wir Ergebnisse. Der Shift ist nicht technischer, sondern kognitiver Natur.
Und er fordert uns heraus:
- als Kommunikator:innen: Wie bereiten wir Inhalte auf, die direkt zitiert werden – ohne dass je geklickt wird?
- als Entscheider:innen: Wie messen wir Erfolg, wenn der Traffic ausbleibt, aber die Antwort stimmt?
- als Nutzer:innen: Wie behalten wir Kontrolle über das, was wir „zufällig“ nicht mehr sehen?
Fazit: Die Suche endet nicht. Sie beginnt nur anders.
KI verändert nicht ob wir suchen, sondern wie wir denken, fragen und urteilen.
Die wichtigste Frage ist daher nicht: „Wie mächtig ist KI?“
Sondern: Was machen wir daraus? Denn die Verantwortung für unser Informationsverhalten bleibt – auch wenn die Antworten schneller kommen.
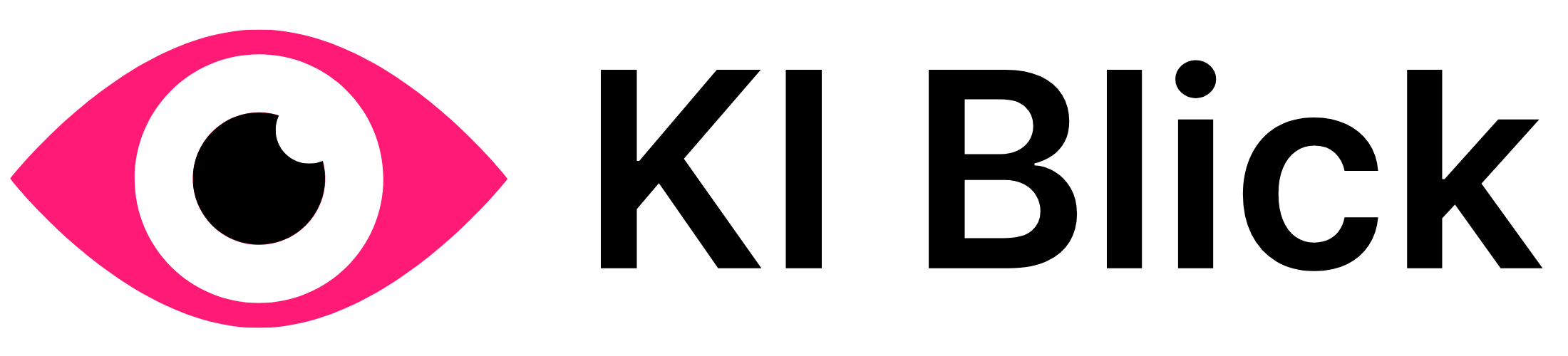



Comments ()